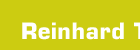 Foto Text Vita |
 |
Fast hundert Meter lang zieht sich die Bodenskulptur, die Reinhard Thürmer auf den leicht ansteigenden Liegewiesen zwischen dem tiefliegenden Wasserspielplatz und dem Paradiesgarten aufgestellt hat. Eingehend auf den Anlaß der Gartenschau greift der Künstler dort verschiedene interpretierende Ortsbezüge auf: einerseits die in dieser Landschaft auffallend häufig vorkommenden schlichten Holzzäune, die Pferdekoppeln unterteilen und Linienzeichnungen auf den Wiesen bilden, andererseits die topographische Eigenheit des Geländes. Obwohl der Titel "28 Elemente" industriell produzierte Teile vermuten läßt, besteht die Installation Thürmers aus nur sparsam bearbeiteten, quadratischen Eichenstämmen. Alle 3 Meter lang, jedoch von unterschiedlicher Dicke, bilden sie auf der Rasenfläche aneinandergereiht eine sich langsam nach oben hin verjüngende Linie und wirken trotz ihrer Wuchtigkeit eher wie ein fragiles Gebilde. Die Kunst schmiegt sich sanft in die Natur hinein. So wird die Bodeninstallation von Reinhard Thürmer ein Pol von überraschender Besänftigung. Die Ruhe, die entsteht, wächst aus der Berührung von Skulptur und Landschaft, indem die Dazugekommene plötzlich mit der gleichen Selbstverständlichkeit vorhanden ist wie Gräser, Blumen, Steine. Die plastischen Elemente sind reduziert, daraus folgt eine besondere Bedeutung der Position der Stämme in der Umgebung, ihrer Größenrelation zu deren natürlichen Gegebenheiten. Die 28 Elemente und das Gelände treten in einen Dialog. Als Anfangs- bzw. Endpunkte eines gedanklichen und geographischen Zusammenhangs schaffen sie zugleich ein Bewußtsein für ein sonst kaum betrachtetes Rasenstück. Dem Besucher werden neue, differenziertere Möglichkeiten der Wahrnehmung einer bestimmten topographischen Situation angeboten. Da sich die Räumlichkeit der Elemente nicht durch eine einzige Dimension erschließen läßt, sondern vielmehr für unterschiedliche Richtungen offen ist, entzieht sich die Installation einer eindeutigen Sichtweise. Die räumliche Interaktion zwischen Installation und Umgebung kann einerseits simultan-bildhaft, andererseits aber auch sukzessiv-bewegungsmotivierend erfahren werden. Sowohl die Rolle der Wahrnehmung, die als kontinuierlicher, nie abgeschlossener Vorgang verstanden wird, als auch die Art des Umgangs mit fast modularen Einheiten erklären, warum Thürmer seiner Arbeit den Untertitel "Für Carl André" gegeben hat. Seine eindrückliche Auseinandersetzung mit den Naturgegebenheiten des Gartenschaugeländes erinnert ansatzweise an die Bodenplastik "Wirbelsäule", die André 1984 für den Baseler Merian-Park geschaffen hatte, und in der er sich mit der Frage der Bewegung auseinandersetzte : "Die Idee einer Skulptur ist die einer Straße. Eine Straße erschließt sich weder von selbst noch von einem bestimmten Punkt aus gesehen ... Viele meiner Werke ( ... ) waren solche, die man mit Fußwegen bezeichnen könnte; sie bewirken, daß man entlang, rundherum oder über das Werk zu gehen hatte. Sie waren gleich Straßen, sicher nicht fixierte Ausblicke. Ich denke, eine Skulptur sollte einen unendlichen Punkt haben." 1 Trotz seiner Reverenz an Carl André läßt sich Thürmer jedoch nicht für die Minimal Art vereinnahmen; er bedient sich auch nur bedingt ihrer Strategien, um seine eigenen Vorstellungen zu entfalten. In "28 Elemente" wird die Priorität und die Nüchternheit der geometrischen Struktur in Frage gestellt. Strenge und Regelmäßigkeit bekommen hier durch die kalkulierte Roheit des Materials einen Sprung. Viele der Holzbalken weisen Risse und Spalten auf und auch die Oberflächen sind selten plan. Die aus den 28 Holzbalken gebildete Linie weist einen Knick und Abstände zwischen den Elementen auf, die ihr einen leichten Rhythmus verleihen. Die minimalistische Form wird inhaltlich geändert, indem sie durch Situationsbezüge in entsprechende Phantasiebezüge gestellt wird und dabei Wirkungen zur Entfaltung bringt. Zwar hat die Bodeninstallation von Reinhard Thürmer Ablauf und Reihung zu Grundthemen, sie enthält aber nicht nur diese formalen Probleme, sondern stellt darüber hinaus eine Kanonerweiterung für den Künstler dar. (Annie Bardon) 1 Carl André, zitiert in : Kunst des 20. Jahrhunderts. Handbuch Museum Ludwig, Köln 1979, S.48 |